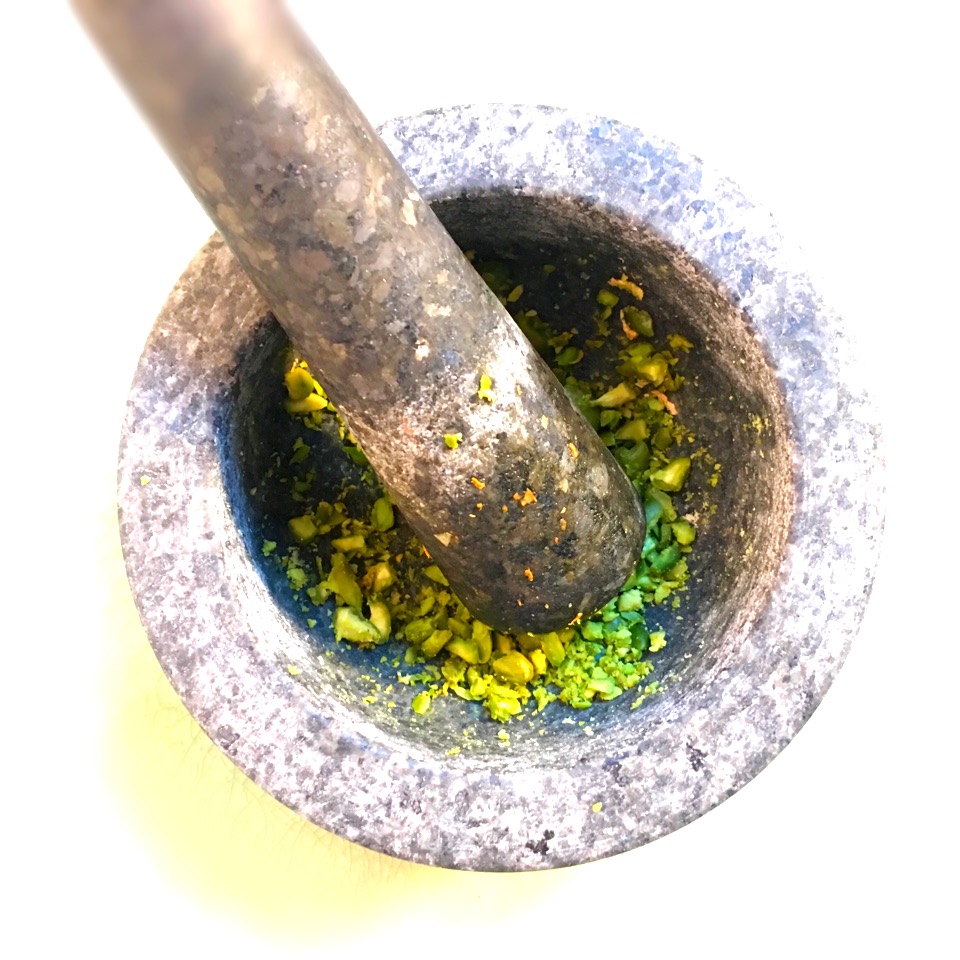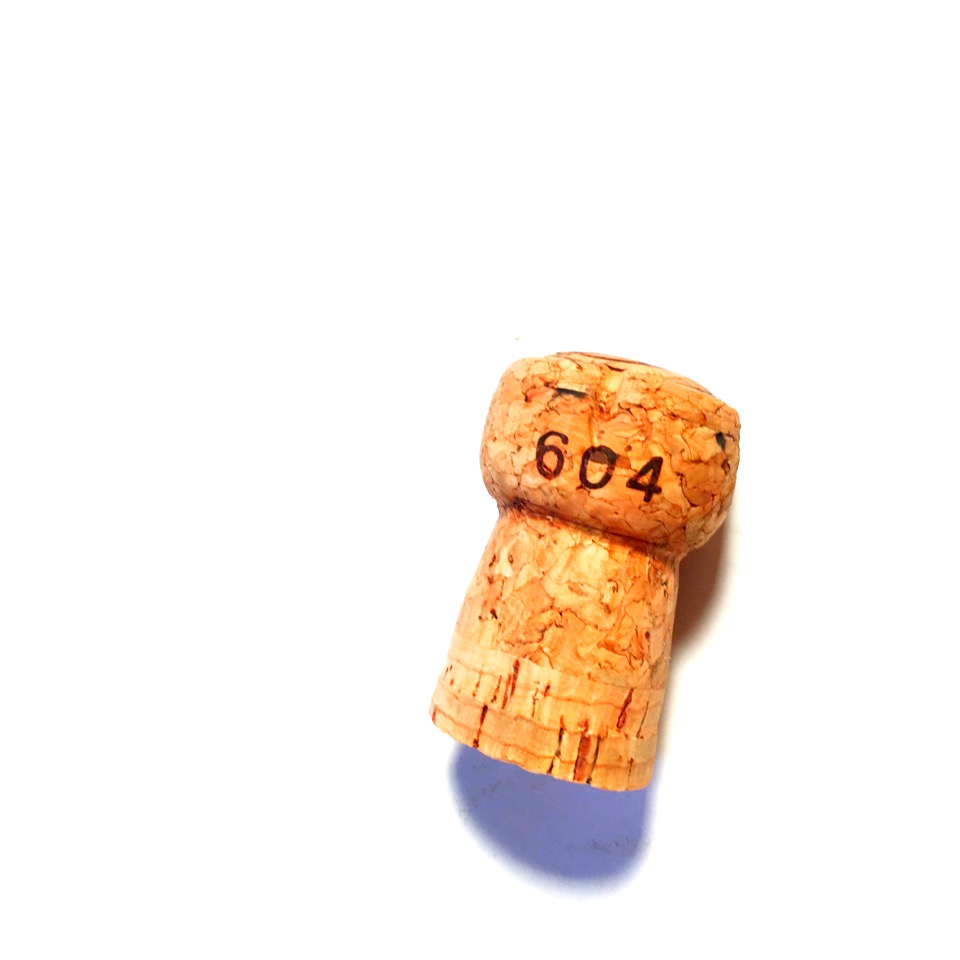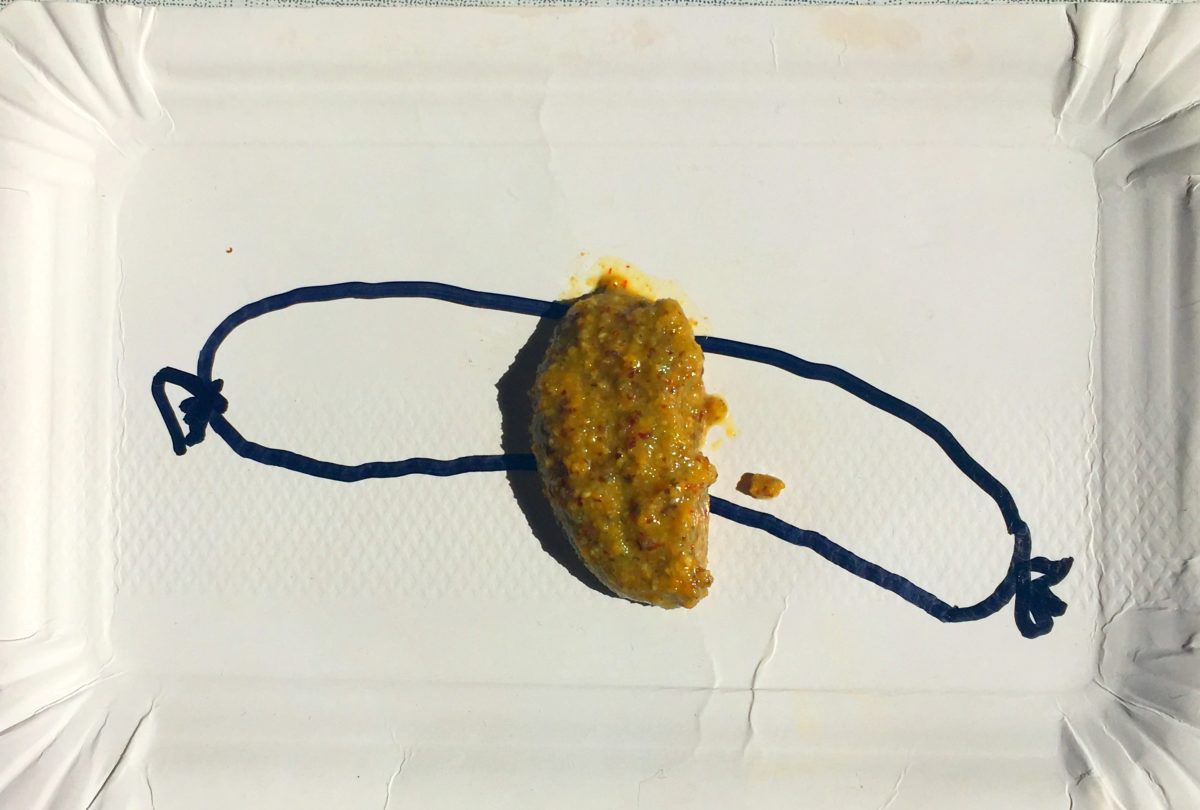Als ich noch klein war, gab es in der Bravo, die ich heimlich im Bus zum Geigen-Unterricht nach Walsrode las, ein Interview mit Billy Idol, von dem ich nicht nur ein Poster mit abgeschnittenen Pyramidennietenhandschuhen, sondern auch eine gekaufte Originalkassette hatte. Er sagte: „Ich weiß nicht, warum Leute sich darüber wundern, dass meine Texte keine Gedichte sind. Ich bin froh, dass es überhaupt Texte sind!“ Damals gab es noch keine Übersetzungsprogramme, daher weiß ich nicht, ob er das wirklich sagen wollte. Beeindruckt war ich trotzdem von seiner Aussage – war ich doch sein größter Rockmusikfan und nicht sein größter Lyrik-Fan. Außer süß sechzehn und weiße Hochzeit habe ich nämlich nicht viel verstanden, obwohl ich schon gar nicht schlecht in Englisch war.
Ob ich mit über Midde 40 meine Idole noch so unkritisch feiere, mag ich gar nicht sagen. Meine Mutter war damals schon froh, dass ich das Poster vom österreichischen Schmierlappen Falco von der Laura-Ashley-Tapete genommen hatte, wenn auch nicht ganz spurlos. Heute mag ich Musik, bei der ich den Text gut verstehe, sehr. Ein Grund, aus dem ich kein Radio höre, zumindest kein muttersprachliches. Soll nicht Musik etwas Genussvolles sein? So wie Essen? Oder sich anfassen? Ein sich Herausbewegen aus der vernünftigen Realität? Einfach mal tanzen? Müssen diese Dinge immer einen großen Sinn ergeben, nur weil heutzutage jeder Pfefferminztee auch die Welt verbessert oder zumindest Dein Karma?
Worauf ich hinaus will, weiß ich jetzt auch nicht genau. Wenn man eine Sprache noch nicht gut kann oder nervös ist oder besoffen, weiß man oft nicht genau, wie oder ob die Satzfolge, die man angefangen hat, zu Ende gehen wird. Diese Satzfolge hier habe ich angefangen, um der Leserin zu antworten, die sagte, meine Texte seien zu textlastig. Hey little sister: Es sind Texte. Mehr nicht und auch nicht weniger.
Deine Luka
PS: Danke, Onkel Cord für die Kassette!